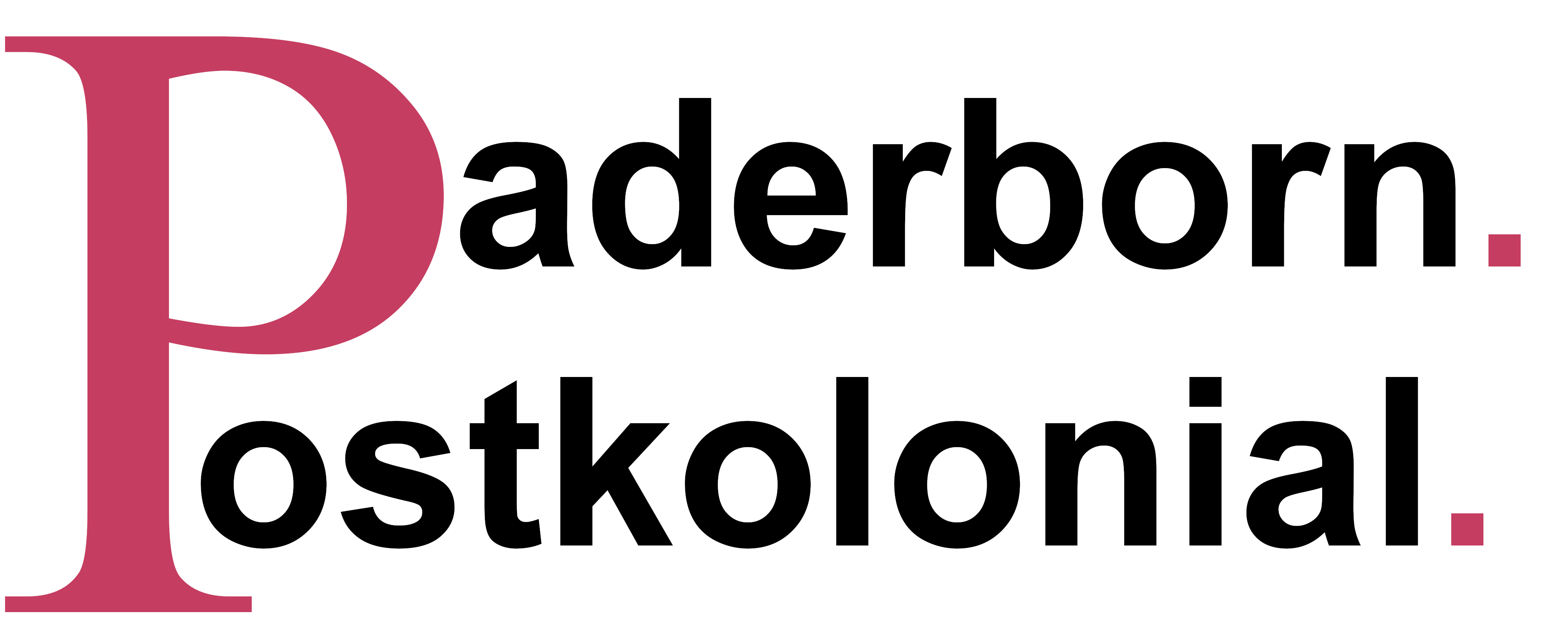Mahagoni an der Pader? Tropische Hölzer in Paderborn? Was auf den ersten Blick ungewöhnlich anmutet, wurde Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in der renommiertesten Möbeltischlerei der Stadt Wirklichkeit, als man in Paderborn intensiv mit wertvollen „exotischen“ Hölzern arbeitete und diese auch gezielt bewarb. Bereits 1863 gründete der Kaufmann Bernard Stadler eine Destillation, aus der später die Werkstätten Bernard Stadler hervorgingen – eine seit 1865 in Paderborn ansässige Möbeltischlerei, die sich auf die Herstellung und den Direktvertrieb von Möbeln und Innenausstattung spezialisiert hatte und die Popularität dieser besonderen Hölzer zu nutzen wusste. In ihren Werbeannoncen wurde die sofortige Verfügbarkeit ausländischer Waren hervorgehoben: „Möbel. Polsterwaaren [sic!] und Decorationen [sic!]. Permanente Ausstellungen vollständiger Zimmer-Einrichtungen, Lager von Möbelstoffen, Gardinen, chinesische Waren etc.“[1] Gegründet wurde das Unternehmen ursprünglich von Bernard Anton Stadler, einem Kaufmann aus dem Münsterland, der sich mit seinen Möbeln im Jugendstil-Design auf eigenen Verkaufsausstellungen in Berlin und anderen Großstädten über Ostwestfalen hinaus einen Name machte. Mit der Etablierung der firmeneigenen Möbelfabrik wurde traditionelle Handwerkskunst mit zeitgenössischer Neugestaltung verbunden, was dem aufkommenden Bedürfnis des 19. Jahrhunderts, sich durch Rauminszenierung gesellschaftlich zu repräsentieren, entsprach: „Die Wohn- und Lebensverhältnisse sind nicht nur Ausdruck individueller Entscheidungen und Vorlieben. In ihnen zeigen sich auch gesellschaftliche und schichtenspezifische Normen. Sie drücken eine soziale Lage aus. Wohnviertel, Straße, Wohnhaus und Rauminszenierung sind immer auch Indikatoren sozialer Strukturen.“[2] Besonders der Besitz „exotischer“ Einrichtungsgegenstände und die Verwendung tropischer Hölzer im Wohnraum symbolisierten einen gehobenen sozialen Status, der Reichtum und kulturelle Gewandtheit zur Schau stellen sollte.
„Exotik“ und Elitismus: Wie tropische Hölzer die bürgerliche Selbstinszenierung beeinflussten
Mit dem aufkommenden Bedürfnis nach bürgerlicher Selbstrepräsentation wurden das private Wohnen und Einrichten zunehmend zu einem zentralen Mittel der Identitätsbildung. Die Wohnkultur entwickelte sich zu einem bewusst inszenierten Rückzugsort, der zugleich den inneren Zusammenhalt stärkte und eine klare Abgrenzung nach außen ermöglichte: „Die Geborgenheit des Gemütlichkeit und Behaglichkeit ausstrahlenden trauten Heims wurde der harten und gefühllosen Realität des Erwerbslebens idealisierend entgegengesetzt.“[3] Die Faszination für das „Exotische“ und „Fremde“[4] im kolonialen Kontext spielte hierbei eine besondere Rolle: „Das Wohnen in beziehungsweise das Sich-Einrichten mit Exotik wurde damit zu einem Akt des Repräsentierens, des ‚Sich-Darbietens‘, wie es auch für andere gesellschaftliche Bereiche, in denen Menschen miteinander Umgang pflegen, konstitutiv ist.“[5] Konsum und Exotismus entwickelten dabei eine enge Verflechtung, wie Wolter betont: „An erster Stelle wirkte sie [die Exotik] unterhaltend. In einer Zeit, die eine ständige Reizung durch visuelle Stimuli als neues städtisches Lebensgefühl feierte […].“[6] Vor allem der Rohstoff Mahagoni entwickelte sich um die Mitte der 1860er Jahre, neben anderen tropischen Hölzern, zu einem besonders exklusiven und modischen Luxusgut des bürgerlichen Wohnens. Dies brachte ihm den Ruf als „König aller Möbelhölzer“[7] ein. Als begehrtes Produkt kolonialen Imports wurde Mahagoni fast ausschließlich in der gehobenen Wohnkultur verwendet: „Mahagoniholz [..] machte die Zugehörigkeit zum gehobenen Bürgertum sichtbar.“[8] Anfangs wurde Mahagoni vor allem in Zentralamerika gewonnen, doch durch die Übernutzung der Bestände begann man Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend afrikanische Mahagoniarten zu verwenden. 1892 wurde erstmals über die Einfuhr des afrikanischen Mahagonis berichtet, das im 19. Jahrhundert als wertvoller, glänzend polierter Werkstoff für Möbelstücke Berühmtheit erlangte.[9] Das Holz zeichnete sich durch seine feine Maserung, Härte und charakteristische Färbung aus und wurde vor allem in der Möbelindustrie, für Inneneinrichtungen und als Furnier verwendet.[10]
Auch die Werkstätten Bernard Stadler erkannten das Potenzial dieser erlesenen Ressource. So findet sich im Westfälischen Volksblatt von 1906 eine Werbeannonce: „Bernard Stadler, Werkstätten und Kaufhaus für die gesamte Wohnungs-Ausstattung. Neu ausgestellt: Hell mahagoni Damenzimmer. Eigener Entwurf.“[11] Das Paderborner Unternehmen griff die Bedeutung tropischer Hölzer als begehrenswertes Statussymbol auf, das stilvolles Wohnen und gehobenen Geschmack signalisierte. Die Hölzer wurden insbesondere von Käufern aus dem Bürgertum und Adel nachgefragt, die sich das exotische Mobiliar leisten konnten. Es wurde vor allem in Räumen verwendet, die nach außen hin als repräsentativ galten, wie Bietz betont: „Im 19. Jahrhundert verwies der Besitz von Mahagoni-mobiliar und anderen aus Mahagoni gefertigten Gegenständen auf Geschmack und gut situierte Vermögensverhältnisse, und trug zum gesellschaftlichen Ansehen seiner Besitzer bei.“[12]. Mahagoniartikel eroberten von nun an den Möbelmarkt und waren aus dem Welthandel nicht mehr wegzudenken.
Die Gründung und Etablierung einer Möbelmanufaktur in Paderborn
Die Werkstätten Bernard Stadler trafen mit der Verwendung hochwertiger Hölzer den Nerv der Zeit und entwickelten sich so zu einem nennenswerten Akteur der Möbel- und Einrichtungsbranche. Der Gründer des Unternehmens, Bernard Anton Stadler, zog im Jahr 1863 nach Paderborn, wo er Ende desselben Jahres die Daltrop’sche Besitzung am damaligen Kettenplatz erwarb (der 1904 in Marienplatz umbenannt wurde). Am 11. Februar 1865 erfolgte der Eintrag seines Unternehmens in das Firmenregister des königlichen Kreisgerichts Paderborn unter dem Namen „Bernard Stadler“ mit Paderborn als Niederlassungsort.[13] Zunächst betrieb Stadler am Kettenplatz eine Destillation, bevor er sich der Möbeltischlerei zuwandte – ein auf den ersten Blick ungewöhnlicher Schritt für einen Kaufmann, der nicht aus dem Tischlerhandwerk stammte. Am 20. April 1867 kündigte ein Inserat in dem Westfälischen Volksblatt die offizielle Eröffnung des „Möbel Magazin der Vereinigten Meister im Hause des Herrn Stadler“ an.[14] Viele Jahre leitete Bernard Stadler das Unternehmen persönlich, bis er sich 1898 altersbedingt sowohl aus der Unternehmensführung als auch aus seiner Tätigkeit als Stadtverordneter zurückzog. Sein Sohn Otto, ein studierter Jurist und Kaufmann, trat bereits 1895 in das väterliche Geschäft ein und führte die Möbeltischlerei weiter, die sich schließlich zu den Werkstätten Bernard Stadler entwickelte. Unter der Leitung von Otto Stadler wurden „[g]ediegene, geschmackvolle Möbel […] gefertigt, deren Stil den Wohnungen eine vornehme Note verlieh.“[15] Der Betrieb beschäftigte im Jahr 1914 weit über 100 Gesellen und Lehrlinge, was vor allem auf die Gründung einer privaten Tischlerfortbildungsschule zurückzuführen war und im Tischlerhandwerk für großes Aufsehen sorgte.[16] Neben Tischlermeister Johannes Meinolph Rhode, der dem Unternehmen 25 Jahre lang als erster Tischler treu blieb[17], wurde im Jahr 1905 der Innenarchitekt Max Heidrich eingestellt. Dieser praktizierte bis 1925 als künstlerischer Leiter und leistete „zur stilvollen Gestaltung der Produktion einen wesentlichen Beitrag.“[18] Heidrich entwickelte sich zu einer prägenden Figur des Unternehmens. Sein Ziel war eine dreiteilige, enge Einheit zwischen Kaufmann, Künstler und Handwerker.[19] Nach einem Großbrand 1928, der die Werkstätten Bernard Stadler in die Knie zwang, arbeitete Heidrich als selbstständiger Architekt weiter und prägte den Baustil vieler Gebäude in der Paderborner Innenstadt, darunter des Kaufhauses Klingenthal an der Ecke Westernstraße/Königsstraße sowie weiterer Hausfassaden an der Marienstraße und am Marienplatz.[20]
Exklusivität trifft Zugänglichkeit: Der Wandel der Möbelproduktion bei Stadler nach der Jahrhundertwende
Nach der Jahrhundertwende nahm die unternehmenseigene Philosophie Impulse des Deutschen Werkbundes auf, an einem zeitgemäßeren Stil zu arbeiten. In verschiedenen Annoncen wurden der Kurswechsel wie folgt beschrieben: „Im neuzeitlichen Geiste durch Max Heidrich entworfene Wohnungseinrichtungen; gediegen, bequem, von durchdachter Zweckmäßigkeit und Sachlichkeit, in sich schön durch die Wirkung des Holzes und die feinfühlig abgewogenen guten Verhältnisse der Formen. Verarbeitung bestgepflegter Hölzer; nur allerbeste Polsterzutaten.“[21] Unter der Führung von Otto Stadler, mit der architektonischen Expertise von Max Heidrich und durch eine Vielzahl von Tischlern, die aus der firmeneigenen Werksschule hervorgingen, erreichte die enge Zusammenarbeit eine Wirkung, die weit über die Grenzen Ostwestfalens hinausging und nationale Anerkennung einbrachte. Ab 1908 wurden die Innenausstattungen der Stadler-Werkstätten deutschlandweit auf Ausstellungen präsentiert. Das Unternehmen verfolgte das Ziel, dem Bedürfnis des Bürgertums nach sofort zugänglichem Konsum gerecht zu werden. Dies verdeutlicht ein Werbetext: „Unser Betrieb ist im Wesentlichen auf Einzelanfertigung nach vorhergehender Bestellung eingerichtet. Daneben führen wir erprobte Formen, in denen durch gleichzeitige Anfertigung mehrerer Stücke eine Reihe besonders preiswerter, sofort greifbarer Zimmereinrichtungen geschaffen ist.“[22] Solche massenproduzierte Waren gewannen allgemein zunehmend an Bedeutung: „In Form der Massenware – stilistisch wie aus einer vergangenen prunkvollen Zeit – konnten sich nun viele diese Produkte leisten und zumindest damit den Adel nachahmen.“[23] Der internationale Durchbruch gelang dem Unternehmen mit dem Gewinn zweier Preise auf der Weltausstellung 1910 in Brüssel, wo es unter anderem einen Auftrag vom Staat Preußen erhielt. In deutschen Großstädten wie Hamburg, Köln und Frankfurt wurden daraufhin eigene Verkaufsstellen eröffnet.[24] Die Werkstätten übernahmen jedoch nicht nur die Anfertigung einzelner Möbelstücke, sondern richteten auch ganze Räume und Ladenflächen ein. Ein Höhepunkt in der Unternehmensgeschichte war die Ausstattung mehrerer Passagierdampfer, darunter ein Rheindampfer und einige Hapag-Dampfer. Im Jahr 1928 wurde das Unternehmen, das mittlerweile als Aktiengesellschaft betrieben wurde, jedoch Opfer einer Brandkatastrophe. Ein Wiederaufbau war aus finanziellen Gründen nicht möglich.[25] Die Bedeutung der Erinnerung an das Unternehmen für die Stadt Paderborn zeigt sich in der posthumen Benennung der Otto-Stadler-Straße im Jahr 1971 zu Ehren des „fortschrittlichen Unternehmers“.
Die Verarbeitung hochwertiger tropischer Hölzer wie Mahagoni aus den Kolonien war eine wichtige Strategie des Unternehmens, um dem wachsenden Bedürfnis nach bürgerlicher Selbstinszenierung Rechnung zu tragen. So ermöglichte es der städtischen Bevölkerung in Paderborn und Deutschland, der Faszination des „Fremden“ zu begegnen und koloniale „Exotik“ in den eigenen vier Wänden zur Schau zu stellen und greifbar zu machen, was ein neues Lebensgefühl vermittelte. Die Verwendung exotischer Materialien aus den Kolonien war nicht nur ein Zeichen von Luxus, sondern auch ein Ausdruck der engen Verbindung zum Kolonialismus in der „Ferne“ – auch in einer Stadt wie Paderborn, die weit entfernt von den Machtzentren der Kolonialherrschaft lag.
[1] Werbeanzeige der Firma Stadler im Sauerländischen Anzeiger vom 8. März 1888, https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/WV42HO3FTESA5VDXOHPGE56ECF4FG56C?issuepage=4, Zugriff am 26.09.2024.
[2] Fünderich, Maren Sophie: Wohnen im Kaiserreich. Einrichtungsstil und Möbeldesign im Kontext bürgerlicher Selbstrepräsentation, Berlin/Boston 2020, S. 53.
[3] Zinn, Hermann: Entstehung und Wandel bürgerlicher Wohngewohnheiten und Wohnstrukturen, in: Niethammer, Lutz (Hg.): Wohnen im Wandel. Beiträge zur Geschichte des Alltags in der bürgerlichen Gesellschaft, Wuppertal 1979, S. 13–27, hier S. 18.
[4] Siehe Pickerodt, Gerhart: Exotisch/Fremd, in: Thoma, Heinz (Hg.): Handbuch Europäische Aufklärung. Begriffe – Konzepte – Wirkung. Stuttgart 2015, S. 201-210.
[5] Schönhagen, Astrid Silvia: Das Interieur als Bühne. Dufours tapeziertes Südsee-Arkadien und die Verinnerlichung naturalisierter „Geschlechtscharaktere“ im Wohnen, in: Schröder, Gerald und Christina Threuter (Hg.): Wilde Dinge in Kunst und Design. Aspekte der Alterität, Bielefeld 2017, S. 8-29, hier S. 22.
[6] Wolter, Stefanie: Die Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des Massenkonsums, Frankurt a. M./ New York 2005, S. 9.
[7] Max Naumann: Das Holz in der Möbeltischlerei, in: Krais, Paul (Hg.): Gewerbliche Materialkunde. Erster Band: Die Hölzer, Stuttgart 1910, S. 471–571, hier S. 476, zitiert nach Fünderich: Wohnen im Kaiserreich, S.110.
[8] Fünderich: Wohnen im Kaiserreich, S. 63.
[9] Vgl. Bietz, Stefanie: Holzhandel und Möbelkonsum in Europa. Zur Selbstdarstellung bürgerlicher Gesellschaftskreise um 1900, in: Themenportal Europäische Geschichte (2010), www.europa.clio-online.de/essay/id/fdae-1536, Zugriff am 26.09.2024.
[10] Vgl. Kiehn, Michael; Rayner, Karin: Mahagoni – wertvolle Tropenhölzer der Alten und Neuen Welt, in: Der Palmengarten. Pflanzen. Leben. Kultur 65 (2001) 1, S. 40-45.
[11] Werbeanzeige der Fa. Bernard Stadler im Westfälischen Volksblatt Paderborn vom 27. Juli 1906.
[12] Bietz, Stefanie: Holzhandel und Möbelkonsum in Europa.
[13] Vgl. Beilage zum Königlich Preußischen Staats-Anzeiger Nr. 44 vom 19. Februar 1865 (https://digi.bib.unimannheim.de/viewer/reichsanzeiger/film/014-7933/0304.jp2), Zugriff am 12.08.2024.
[14] Westfälisches Volksblatt vom 20. April 1867 (https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/394301), Zugriff am 12.08.2024.
[15] Auffenberg, Karl und Klaus Terstesse: Brand bei Stadler, in: Die Brücke 36 (1992), S. 8-9, hier S. 8.
[16] Vgl. Reininghaus, Wilfried: Das Handwerk in Paderborn im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Grundzüge der gewerblichen Entwicklung Paderborns, in: Westfälische Zeitschrift, Band 139 (1989), S. 361–379.
[17] Vgl. Westfälisches Volksblatt vom 6. 12. 1913, (https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/530180), Zugriff am 12.08.2024.
[18] Auffenberg, Brand bei Stadler, S. 8.
[19] Stadt- und Kreisarchiv Paderborn; Archivale Nr. 3109: “Werkstätten Bernard Stadler AG Paderborn. Kaufmann, Künstler, Handwerker“.
[20] Vgl. „Denkmalschutz für Heidrich-Fassaden“, in Neue Westfälische vom 4. 07. 2013, https://www.nw.de/lokal/kreis_paderborn/paderborn/8810540_Denkmalschutz-fuer-Heidrich-Fassaden.html, Zugriff am 13.08.2024.
[21] Stadt- und Kreisarchiv Paderborn; Werbeannonce „Werkstätten Bernard Stadler Paderborn.“
[22] Werbe Stadt- und Kreisarchiv Paderborn; Werbeannonce „Werkstätten Bernard Stadler Paderborn.“
[23] Bühler, Peter et al.: Designgeschichte. Epochen – Stile – Designtendenzen, Berlin/Heidelberg 2019, S. 36.
[24] Vgl. Stadt- und Kreisarchiv Paderborn; Archivale: Zum 19. Todestag von Otto Stadler.
[25] Vgl. Auffenberg, Brand bei Stadler, S. 9.